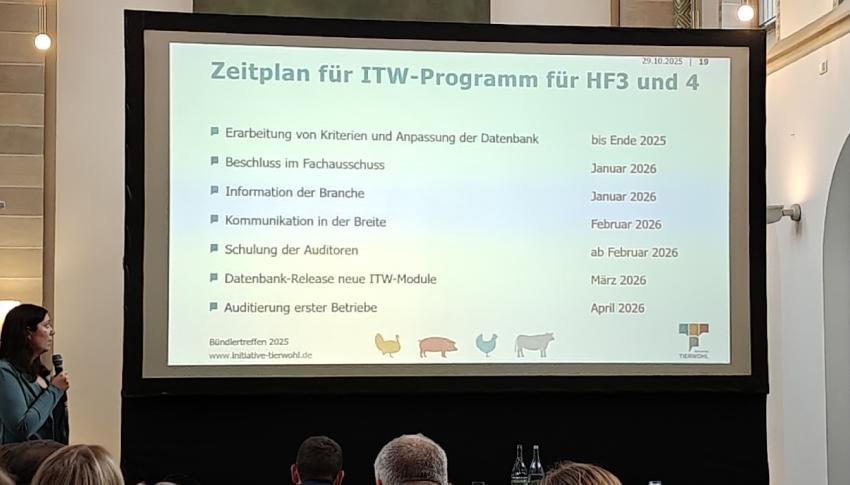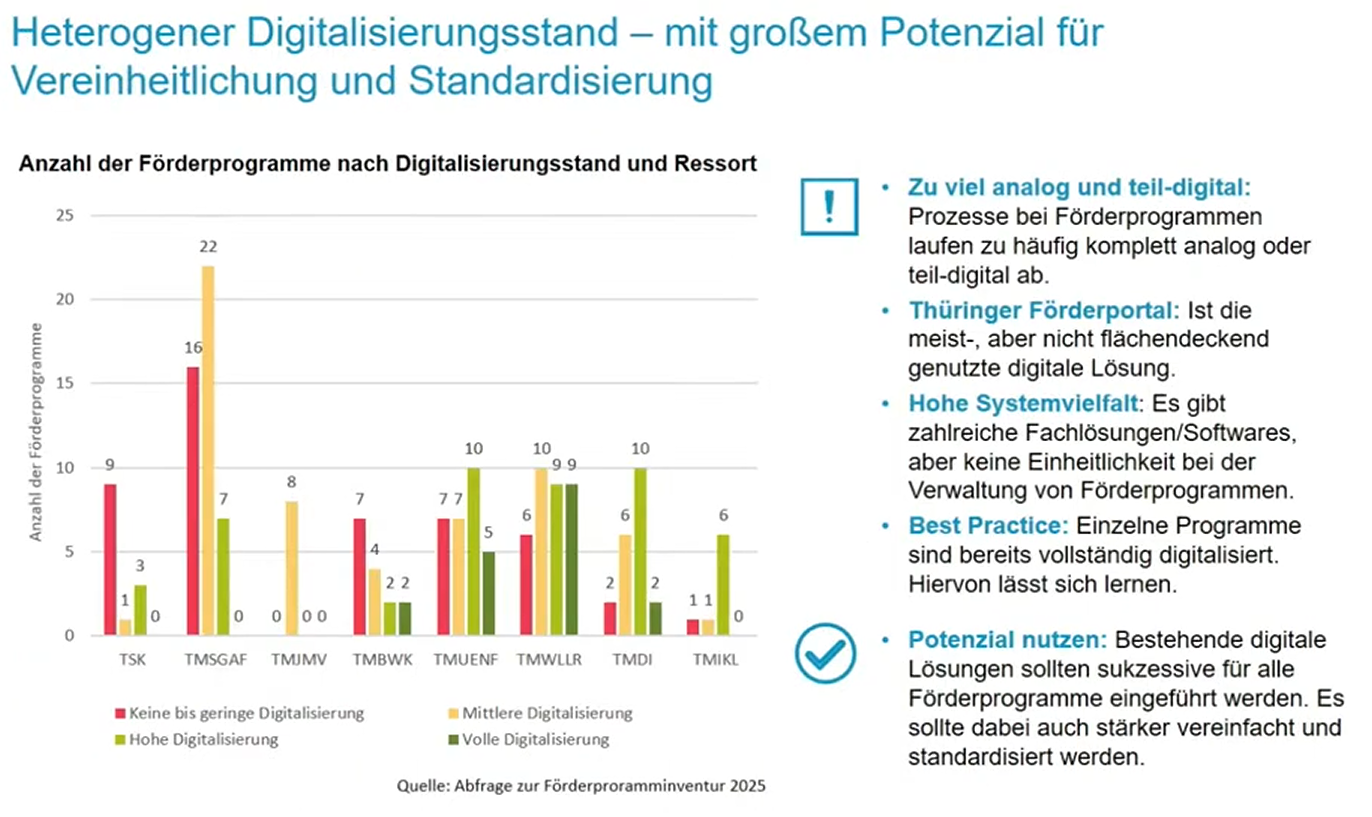Der Thüringer Bauerverband (TBV) richtet, dank der Unterstützung von Mitgliedern, Fördermitgliedern und Partnern am 21. November wieder einen Bauernball im Bio-Seehotel in Zeulenroda aus.
Ein unvergesslicher Abend – Das erwartet Sie beim Bauernball
Inmitten des Thüringer Vogtlandes befindet sich das mehrfach ausgezeichnete 4* Superior Hotel mit einem hohen Maß an Qualität und Atmosphäre in idyllischer Lage am Ufer des Zeulenrodaer Meeres. Im stilvollen Karpfensaal des Hotels laden wir Sie zum Tanzen und Beisammensein unter Freunden ein. Neu dabei ist die Band LuxusLoft, die mit ihrem frischen Sound und einer mitreißenden Show für beste Stimmung und volle Tanzflächen sorgen wird.
Kulinarische Highlights inklusive
Im Kartenpreis enthalten ist ein vielfältiges Büfett mit regionalen Produkten. Zusätzlich genießen Sie ein Mitternachts-Büfett sowie Getränke wie Biere, Weine und Alkoholfreies aller Art über den gesamten Abend.
Hochwertige Tombola – Jedes Los gewinnt!
Eine hochwertige Tombola, zu der jeder Gast mit seiner Eintrittskarte beim Einlass ein Los erhält, garantiert einen Preis – darunter zehn Hauptpreise im Wert von bis zu 2.000 Euro.
Eintrittskarten zum diesjährigen Bauernball erhalten Sie für 130,00 Euro.
Die Kartenreservierungen nehmen wir unter Angabe Ihres Namens und der Adresse unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! entgegen.
Mit dem Stichwort "Bauernball 2025" können im Bio-Seehotel Zimmer unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch unter +49 (0)36628 981 07 aus dem dafür vorgesehenen Zimmernkontingent bis 3. November reserviert werden. Die Doppelzimmer erhalten Sie zum Vorzugspreis von 199 Euro.
Wer uns bei der Ausgestaltung des Bauernballs noch unterstützen möchte, meldet sich bitte bei Katja Förster unter +49 (0)361 262 532 29 oder unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und zahlreiche Kartenreservierungen.