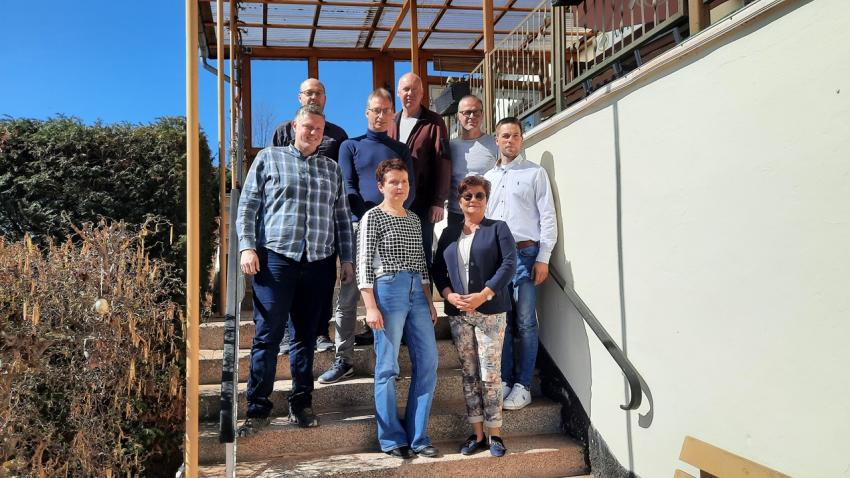Der CERES AWARD – Landwirt des Jahres zeichnet Landwirtinnen und Landwirte aus, die tagtäglich außergewöhnliche Leistungen erbringen. Durch die mediale Aufmerksamkeit trägt die Auszeichnung dazu bei, unsere moderne Landwirtschaft transparenter darzustellen, Akzeptanz zu fördern und das öffentliche Bewusstsein nachhaltig zu stärken. Entscheidend sind dabei nicht Höchstleistungen, sondern innovative und nachhaltige Betriebskonzepte mit Unternehmertugenden wie Mut, Ideenreichtum sowie Verantwortungsbewusstsein für Mitmensch, Tier und Umwelt. Nutzen Sie die einzigartige Chance, herauszustellen, was Sie leisten!
Bewerben Sie sich jetzt:
Mit einer direkten Bewerbung oder laden Sie die Bewerbungsunterlagen runter und senden diese bis 13. April ein.
Hintergrund:
Im vergangenen Jahr kam die Unternehmerin des Jahres aus Thüringen: Anja Kolbe-Nelde aus Schönewerda überzeugte die Jury des CERES AWARDS und siegte in der Kategorie Unternehmerin.
„Ich bin total überrascht und habe eigentlich gar nicht daran geglaubt, denn jeder von uns hier hat diesen Preis verdient. Für uns ist dieser Preis ganz wichtig, denn Trüffelanbau gehört zur Landwirtschaft dazu und ist in Deutschland mit hohen Erträgen möglich“, sagte Anja Kolbe-Nelde auf der Bühne des CERES AWARDS 2024. Trüffelanbau ist eine Branche der Landwirtschaft und kann einen kleinen Anschub gebrauchen. Der Unternehmerin des Jahres ist es wichtig, ihre Arbeit in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und die Zusammenarbeit mit Landwirten zu stärken. Die Jury überzeugte sie mit ihrem Mut, ihrer Entschlossenheit und großen Expertise im Pilz- und Trüffelanbau. Sie sei ein besonderes Vorbild für die Landwirtschaft.
Anja Kolbe-Nelde gründete 2016 ihr erfolgreiches Unternehmen. Seither baut sie auf 2.000 Quadratmetern parasitisch lebende Pilze wie Austernseitlinge, Rosenseitlinge, Limonenseitlinge und Shiitake so natürlich wie möglich im Freiland an. Im Mittelpunkt ihres Unternehmens steht aber ganz klar der Anbau von Trüffeln. Neben der eigenen Trüffelbaumschule bewirtschaftet die Unternehmerin knapp drei Hektar selbst. Auf dieser Plantage ist ihr vor kurzem eine absolute Sensation gelungen: der Fund der ersten Trüffeln nach 5 Jahren – normalerweise gehen Trüffelplantagen erst nach frühestens sieben Jahren in den Ertrag. Damit die Trüffel erfolgreich wachsen, bietet Anja Kolbe-Nelde neben der Anlage von ganzen Plantagen für Landwirte auch Anbauberatung, Planung und Managementunterstützung nach dem Thüringer Modell an. „Trüffel gelten dabei als Dauerkultur, sodass der Ackerstatus erhalten bleibt“ erklärt die Unternehmerin.